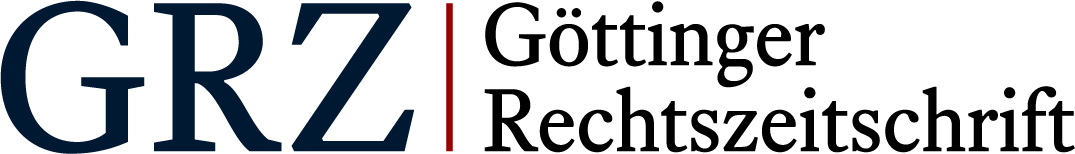Über uns
Die GRZ ist eine studentische Rechtszeitschrift an der Georg-August-Universität Göttingen und wird von Studierenden und Promovierenden der Juristischen Fakultät konzipiert und herausgegeben.
Sie versteht sich als Ausbildungszeitschrift und soll Studierenden und jungen Wissenschaftler:innen die Möglichkeit zur Publikation eigener wissenschaftlicher Beiträge geben.
Mitteilungen
-
22.02.2024
Hausarbeiten-Workshop
Du musst in Deinen Semesterferien eine Hausarbeit schreiben, bist aber noch unsicher, wie du anfangen sollst?
Unser Workshop zum wissenschaftlichen Arbeiten am 07.03.24 um 18 Uhr s.t. bietet Dir eine Hilfestellung. -
16.11.2023
Transitional Justice: Umgang mit Folgen von Krieg und Konflikt - Veranstaltung aus der Reihe "Recht interdisziplinär"
Am Donnerstag, dem 23.11.2023, ab 18.15 Uhr widmet sich die neue Veranstaltung aus der Reihe "Recht interdisziplinär" dem Konzept "Transitional Justice". Anhand konkreter Praxisbeispiele soll der Frage nachgegangen werden, wie dieses Konzept nachhaltig die Folgen von Krieg und Konflikt überwinden will. Welche Instrumente und Zielkonflikte existieren? Wer sind die zentralen Akteure und wie nehmen diese die unterschiedlichen Instrumente wahr? Welche Erfolge gibt es und wie stabil sind diese? Diese und weitere Fragen werden vor Ort im ZHG 102 diskutiert. Verfolgt werden kann die Diskussion auch via Livestream.
-
04.05.2023
Alles neu macht der Mai
Herzlich Willkommen auf der neuen Homepage der Göttinger Rechtszeitschrift! Nach langer Arbeit und großartiger Unterstützung durch die SUB Göttingen sind wir nun vollständig auf das "OJS" System umgezogen. Dieses ist auf die digitale Publikation von Zeitschriften zugeschnitten und wird daher die GRZ und ihre Beiträge zukünftig besser zur Geltung bringen.